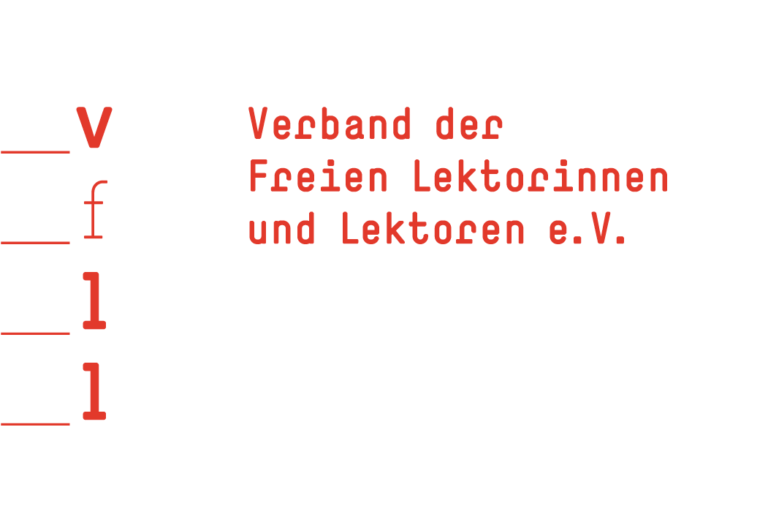Heute geht’s um ein Thema, das längst zum Sprach- und Kulturkampf geworden ist: gendern in Unternehmen – oder besser nicht? Kritik trifft vor allem offensichtlich gegenderte Schreibweisen wie „Kund*innen“, „Auftraggeber:innen“ oder „Arbeitgebende“.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Nutzen Sie Paarformen, Sternchen oder andere Sonderzeichen? Fragen Sie sich, ob Sie konsequent gendern? Oder ob Sie überhaupt geschlechtergerecht schreiben müssen? Tatsache ist: Nicht zu gendern, bietet für Unternehmen gewisse Vorteile – aber auch das generische Maskulinum ist eine gegenderte Form.
In diesem Beitrag greife ich einige Punkte rund ums Gendern auf: ein Leitfaden für Unternehmen und (Solo-)Selbstständige – und im Idealfall eine Entscheidungshilfe für oder gegen geschlechtergerechte Schreibweisen. Falls Sie sich fürs Gendern entscheiden oder entschieden haben, gebe ich Ihnen außerdem einige Grundsatzfragen mit: damit Sie Stolpersteine und Inkonsequenzen vermeiden.
So halte ich es mit der Genderei
Als Werbelektorin bin ich beim Thema „Gendern“ neutral: Diese Entscheidung treffen die Unternehmen, für die ich arbeite.
In meinen eigenen Texten verwende ich dagegen Paarformen und neutrale Begriffe, bleibe aber auch beim generischen Maskulinum: beispielsweise bei längeren Sätzen und sehr vielen Paarbezeichnungen. Mir liegt daran, leserliche Texte zu schreiben – und gleichfalls eine rein maskuline Sprache zu entschärfen. Dadurch, so hoffe ich, kann ich Besucherinnen meiner Website ein angenehmeres Leseerlebnis bieten.
Gendern oder nicht gendern in Unternehmen – und ein Leitfaden für die Rechtschreibung
1. Generisches Maskulinum
Wenn Sie das generische Maskulinum verwenden, bezeichnen Sie mit männlich-maskulinen Schreibweisen Männer, Frauen und diverse Menschen: Auf andere Art und Weise gendern Sie also auch hier. Falls Sie zu Beginn einen Hinweis wie den folgenden ergänzen, machen Sie das nachdrücklich deutlich:
Um die Lesbarkeit zu verbessern, verwenden wir allein das generische Maskulinum. Allerdings sprechen wir damit alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten an.“
Probleme in Sachen Rechtschreibung? Nein. Das generische Maskulinum entspricht voll und ganz den Regeln des Rats für deutsche Rechtschreibung, der zentralen Instanz für orthografische Grundsatzfragen.
2. Paarformen und verkürzte Doppelnennungen
Wenn Sie allein Männer und Frauen kennzeichnen wollen, können Sie Paarformen oder verkürzte Doppelbenennungen nutzen:
- „Kolleginnen und Kollegen“,
- „Mitarbeiter(inn)en,
- „Kund/-innen“,
- „Interessent/innen“ oder
- „KäuferInnen“.
Probleme in Sachen Rechtschreibung? Neben Paarformen hat der Rat für deutsche Rechtschreibung bislang nur die Schreibung mit Schräg- und Bindestrich als regelkonform anerkannt:
- „Wortteile: Krankenpfleger/-in, die Schüler/-innen der Realschule, das Angebot der Unternehmer/-innen“ (Paragraf 83).
Dabei dürfen Schräg- und Bindestriche nur gesetzt werden, wenn
- „die gekürzte Form formgleich mit der ungekürzten ist: Möglich ist die Schüler/-innen (die Schüler und Schülerinnen), nicht möglich ist den Schüler/-innen (den Schülern und Schülerinnen)“ (Paragraf 83: Hinweise).
In der Praxis allerdings werden inkorrekte Formen gemeinhin toleriert:
- „den Schüler/-innen“,
- „überdurchschnittlich viele Anwält/-innen“ oder
- „unter unseren Physiotherapeut/-innen …“.
Schreibungen mit Schrägstrich, aber ohne ergänzenden Bindestrich, Einklammerungen oder das Binnen-I lässt der Rat für deutsche Rechtschreibung vorerst unberücksichtigt.
3. Sonderzeichen
Mit Sonderzeichen machen Sie nicht nur Frauen und Männer, sondern auch diverse Geschlechter sichtbar:
- „Kolleg*innen“,
- „Kund:innen“,
- „Interessent_innen“.
Probleme in Sachen Rechtschreibung? Der Rat für deutsche Rechtschreibung führt unter Sonderzeichen die heute gängigen Schreibungen mit Gender-Stern, Doppelpunkt und Unterstrich an, erwähnt aber auch:
- „Diese Wortbinnenzeichen gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie.“
Darüber hinaus lässt der Rat grammatisch inkorrekte Formen wie „bei unseren Mitarbeiter*innen“ außer Acht. Auch andere Aspekte bleiben unberücksichtigt: Die weitere Entwicklung werde beobachtet – und schlägt sich gegebenenfalls künftig in orthografischen Regeln nieder.
4. Neutrale Formulierungen
Durch neutrale Formulierungen wird das Geschlecht quasi unsichtbar. Dennoch beziehen Sie Frauen, Männer und alle anderen Geschlechter ein: in Begriffe, Wortgruppen und Partizipien wie
- „Fachleute“ und „Servicekräfte“,
- „Kundschaft“ oder „Bekanntschaft“: auch Wörter, bei denen das generische Maskulinum mehr oder weniger klar erkennbar bleibt, gelten als neutral („Ärzteschaft“, „Partnerschaft“, „Nachbarschaft“),
- „Holen Sie ärztlichen Rat ein und fragen Sie in Ihrer Apotheke“ statt „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“,
- „Alle, die teilnehmen …“ oder „Wer teilnimmt …“ statt „Die Teilnehmer …“,
- „Teilnehmende“, „Mitarbeitende“ oder „Beschäftigte“.
Probleme in Sachen Rechtschreibung? Nein. Ebenso wie das generische Maskulinum sind neutrale Formulierungen orthografisch völlig korrekt.
Gendern oder nicht gendern in Unternehmen: Vor- und Nachteile
Egal, ob Sie gendern oder nicht: In beiden Fällen positionieren Sie sich – was für Unternehmen und Selbstständige Vorteile, aber auch Nachteile haben kann.
Vorteile
Wenn Sie nicht gendern,
- wirken Ihre Texte auf die Menschen sympathischer, die das Gendern mehr oder weniger ablehnen,
- nutzen Sie gängige und vertraute Schreibweisen: Ihre Texte lassen sich gut lesen,
- formulieren Sie kürzer als mit Paarformen und Sonderzeichen,
- schreiben Sie konform geltender Rechtschreibregeln.
Wenn Sie gendern,
- beziehen Sie Frauen und/oder diverse Menschen ein,
- sprechen Sie beide Gruppen als Zielgruppen an: vorteilhaft, da Menschen nun mal emotional entscheiden,
- können Sie Ihre Kundinnen und Kunden „filtern“, falls Sie Schulungen oder (Online-)Seminare anbieten: Sie ziehen Menschen an, die das Gendern akzeptieren oder tolerieren – und die Ihre Ansichten teilen.
Nachteile
Wenn Sie nicht gendern,
- schließen Sie Frauen und diverse Menschen aus: ein Nachteil, wenn beide zu Ihrer Zielgruppe gehören oder Ihre alleinige Zielgruppe sind,
- werden Ihre Texte auf beide Gruppen unsympathisch wirken: wenn sich Frauen und/oder diverse Menschen Zeit für ihre Entscheidungen nehmen, fallen Sie durchs Raster.
Wenn Sie gendern,
- verschlechtert sich die Lesbarkeit Ihrer Texte: Paarformen oder Gender-Sterne und Co. en masse nerven schnell: gerade im Singular („Die*der Abteilungsleiter*in bespricht mit ihren*seinen Kolleg*innen alle Aspekte, die für sie*ihn relevant sind“),
- können neutrale Formulierungen sperrig und unvorteilhaft lang wirken („Bauarbeiten ausführendes Fachpersonal“ statt „Bauarbeiter“),
- fehlen tendenziell Richtlinien zu regelkonformer Orthografie.
Sie (wollen) gendern? Ein Leitfaden für Ihr Unternehmen
Vielleicht helfen Ihnen diese Pro- und Kontra-Argumente: falls Sie noch nicht übers Gendern entschieden haben – oder falls Sie noch über Ihre Kundenkommunikation nachdenken. Wenn Sie dagegen bereits gendern (wollen), sollten Sie sich diese Fragen stellen:
- Wollen Sie alle Geschlechter ansprechen oder nur Männer und Frauen?
- Geht’s darum, das Geschlecht sichtbar zu machen – oder durch neutrale Formulierungen quasi unsichtbar?
- Möchten Sie das Geschlecht immer kennzeichnen? Vielleicht leiten Sie eine Kita und wollen in Texten über zu betreuende Kinder nicht eigens gendern. Praxistipp: Falls Sie fürs Gendern plädieren, empfehlen sich neutrale Formulierungen – vielleicht „Die Kleinen können beim Malen und Basteln kreativ sein“.
- Sollen Zusammensetzungen gegendert werden: „Interessent*innengruppen“, „Mitarbeiter/-innenversammlung“ oder „kund:innenfreundlich“? Oder bleibt es bei „Mitarbeiterversammlung“ und „kundenfreundlich“? Praxistipp: Wenn Sie gendern, formulieren Sie mit gegenderten Zusammensetzungen einheitlich – und konsequenter.
- Wie gehen Sie mit englischen (Berufs-)Bezeichnungen um: „die Choachin“ oder „der Coach“, „Senior Managerin“ oder „Senior Manager“, „Follower:innen“ oder „Follower“? Praxistipp: Im Deutschen gängige Anglizismen („User“, „Follower“) können Sie zugunsten der Einheitlichkeit gern gendern. Verzichten würde ich bei Begriffen wie „Facility Manager“ und „Senior Consultant“. Und „Choachin“ wäre für mich okay, wenn Sie als Soloselbstständige über sich schreiben – oder wenn es ausschließlich um Frauen geht.
- Schreiben Sie über echte Menschen oder über Unternehmen, Institutionen oder Gremien: bei „die Auftraggeber“, „unsere Kunden“ und „unsere Lieferanten“? Bei Unternehmen oder Institutionen sind gegenderte Schreibweisen unangebracht, bei Menschen wären sie nötig: „Mein Auftraggeber ist das Unternehmen XY“ und „Meine Ansprechpartner*innen im Unternehmen XY sind …“. Praxistipp: Ich persönlich wähle auch bei Substantiven wie „die Volkshochschule“ oder „die Volkswagen AG“ maskuline Bezeichnungen.
- Was ist Ihnen wichtiger: konsequentes Gendern oder optimal zu lesende Texte? Nehmen Sie allzu umständliche Formulierungen mit Gender-Sternen, Doppelpunkten oder Unterstrichen in Kauf? Nutzen Sie gewöhnungsbedürftige neutrale Umschreibungen („Katzenhaltende“)? Oder setzen Sie auf gute Lesbarkeit?
Gendern im Unternehmen: Das sollten Sie außerdem beachten
Egal, ob Sie Paarformen, neutrale Formulierungen, Schrägstriche, Gender-Sterne oder Doppelpunkte nutzen – beachten Sie diese Schreibtipps:
- Es gibt neutrale, als solche sächliche Substantive: „das Mitglied“ zum Beispiel. „Mitglieder*innen“ wäre daher völlig daneben.
- Weitere Begriffe sind neutral, grammatisch allerdings maskulin: „der Mensch“, „der Fan“, „der Star“ oder „der Liebling“. „Mensch:innen“ oder „FanInnen“ wäre zu viel des Guten.
- Neutrale Bezeichnungen („Mitarbeitende“, „Studierende“, „Lehrende“) sind nur im Plural neutral: „Ein neuer Mitarbeitender“ ist genauso männlich wie „ein neuer Mitarbeiter“.
- Neutrale Formulierungen wirken durchaus missverständlich: „Dozierende“ können an einer Hochschule unterrichten – oder einen belehrenden Ton anschlagen. Und „Bewerbenden“ geht es um eine offene Stelle oder sie werben für bestimmte Produkte. Hier sollte aus dem Kontext deutlich werden, was Sie meinen.
- Wie bereits erwähnt: Wenn Sie verkürzte Doppelbenennungen oder Sonderzeichen nutzen, formulieren Sie besser im Plural. Im Singular müssen Sie Artikel, Pronomen und mögliche Adjektive ebenfalls gendern – und das ist einfach unleserlich.
- Wenn Sie Paarformen verwenden, greifen Sie bei mehreren Paarbezeichnungen abwechselnd zu männlichen und weiblichen Formen. So verkürzen Sie Ihren Text und schreiben leserlicher.
Zu guter Letzt
Okay: Sie gendern auch, wenn Sie das generische Maskulinum verwenden – aber niemand zwingt Sie, Gendersterne, das Binnen-I oder Paarformen zu nutzen. Gendern kann für Unternehmen Vor- und Nachteile haben, nicht gendern aber auch. Entscheiden Sie daher mit Blick auf Ihre Zielgruppe(n) und auf Ihr Business.
Wenn Sie allerdings geschlechtergerecht schreiben, sollten Sie vorab einige Grundsatzfragen klären: damit Sie konsequent gendern – und im Falle eines Lektorats auch Ihrer Lektorin oder Ihrem Lektor entsprechende Richtlinien mitgeben können.
Weiterlesen?
- Corporate Language: Eine individuelle Unternehmenssprache bringt jede Menge Vorteile
- „Das steht im Duden, das ist korrekt“ …?
- Korrektorat oder Lektorat: Welche Unterschiede gibt’s?
- Texte lektorieren lassen? Dann sind diese Informationen wichtig!